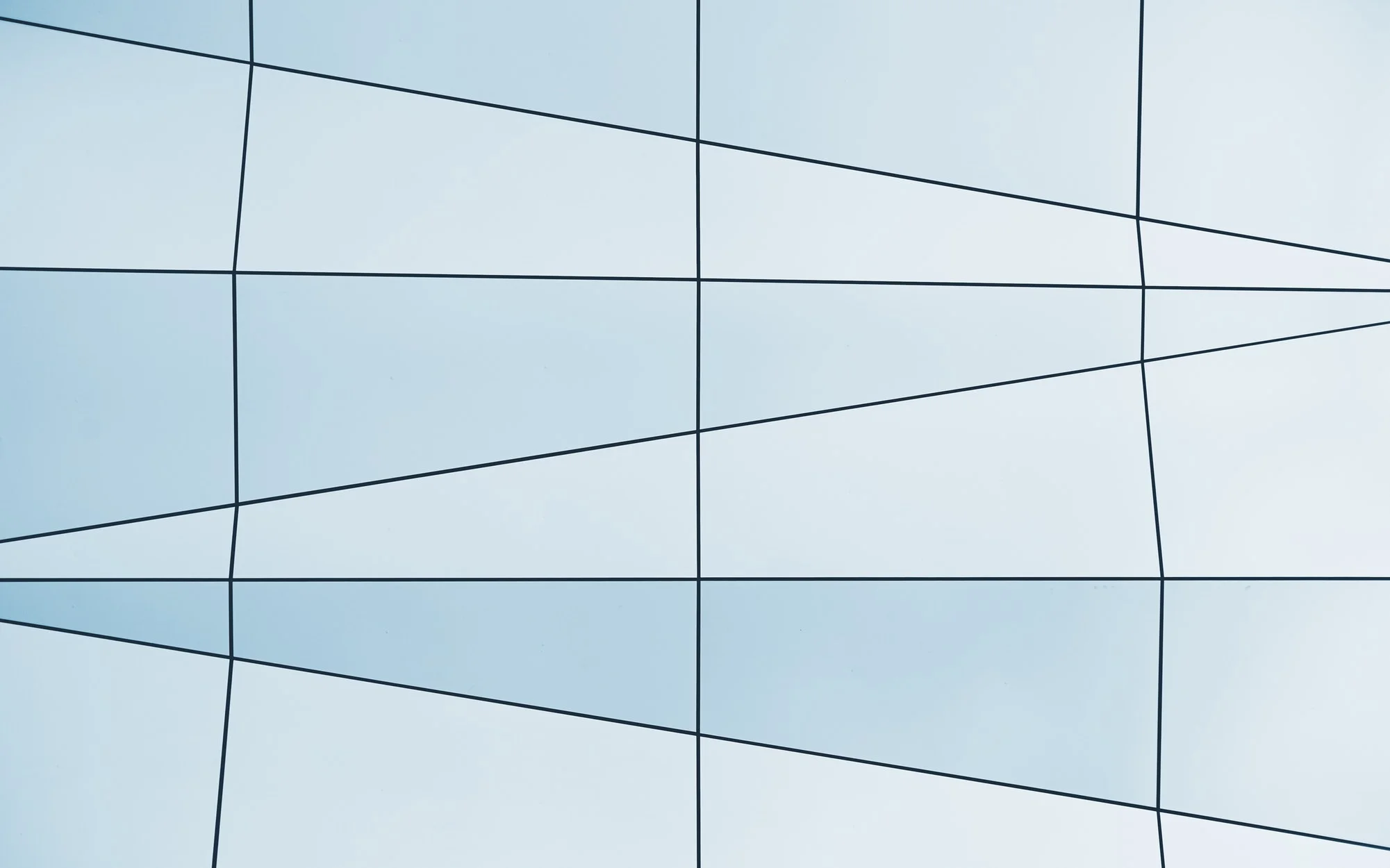Welches Gericht ist zuständig, wenn ein deutscher Verbraucher eine Urlaubsreise auf einer ausländischen Website bucht und diese mangelhaft ist? Kann er dann vor einem deutschen Gericht klagen oder muss er das in dem Land, aus dem die Website stammt?
Was ist, wenn ein ausländischer Hotelgast seine Übernachtung nicht bezahlt, diese aber zuvor im Internet gebucht hatte? Muss das Hotel den Gast dann in dessen Wohnsitzstaat verklagen?
Oft handelt es ich bei den Betreibern von Websites um Unternehmen mit Sitz im Ausland. Da stellt sich die Frage, welchem Recht deren Angebote unterliegen und vor allem in welchem Land sie zu belangen und verklagen sind. Denn es ist meist mit erhöhtem Aufwand verbunden in einem anderen Land Klage zu erheben, da z.B. eine andere Amtssprache gilt und ein ausländischer Anwalt beauftragt werden muss.
Welcher Gerichtsstand gilt grundsätzlich im Internet?
Bei Internetbuchungen oder –einkäufen ist der Gerichtsstand für Klagen nicht automatisch im Land des Wohnsitzes. Es kommt auf den Willen des Unternehmers an, auch im jeweiligen Land tätig zu sein. So der Europäische Gerichtshof (EuGH).
Der EuGH präzisierte damit die unionsrechtlichen Regeln über die gerichtliche Zuständigkeit für Verbraucherverträge in Fällen, in denen Dienstleistungen im Internet angeboten werden.
Geltende Rechtslage im EU-Recht
Nach der Verordnung der Europäischen Union über die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen sind Klagen gegen Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, in der Regel vor den Gerichten dieses Staates zu erheben.
Des Weiteren kann die Klage am Erfüllungsort erhoben werden, d.h. beim Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung aus dem Vertrag erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre.
Liegt hingegen ein Verbrauchervertrag vor, gelten besondere Regeln, die den Verbraucher schützen sollen: Hat der Unternehmer seine Tätigkeit auf den Mitgliedstaat „ausgerichtet“, in dem der Verbraucher wohnt, kann der Verbraucher eine etwaige Klage beim Gericht des Mitgliedstaats erheben, in dem er selbst wohnt, und umgekehrt auch nur in diesem Staat verklagt werden.
«Ausrichtung» der Tätigkeit auf andere Staaten
Fraglich ist jedoch, wann ein Internetunternehmer seine Tätigkeit auf ein bestimmtes Land „ausrichtet“? Oder ob bereits darin, dass ein in einem Mitgliedstaat der EU niedergelassenes Unternehmen seine Dienstleistungen über das Internet anbietet, eine „Ausrichtung“ seiner Tätigkeit auch auf andere Mitgliedstaaten liegt? Die Beantwortung dieser Fragen ist deshalb wichtig, da im Fall eines Rechtsstreits dann die günstigeren Zuständigkeitsregeln der Verordnung Anwendung fänden, die dem Schutz der Verbraucher anderer Mitgliedstaaten dienen.
Dazu hat der Gerichtshof nun in zwei Fällen Stellung bezogen und ein Urteil gefällt. In den beiden Rechtsstreitigkeiten geht es um die Frage, ob ein Gewerbetreibender seine Tätigkeit im Sinne der Verordnung auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers „ausrichtet“, wenn er zur Kommunikation mit den Verbrauchern eine Website nutzt.
Wille des Unternehmers ist massgeblich
Der Gerichtshof stellte klar, dass durch die bloße gewerbliche Nutzung einer Website durch einen Unternehmer als solche noch nicht bedeute, dass er seine Tätigkeit auf andere Mitgliedstaaten „ausrichtet“. Vielmehr sei entscheidend, dass der Unternehmer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern anderer Mitgliedstaaten herzustellen.
Anhaltspunkte für internationale „Ausrichtung“
Anhaltspunkte für den Willen des Unternehmers, auch im jeweiligen Land tätig zu sein, können laut EuGH folgende sein:
- Alle offenkundigen Ausdrucksformen des Willens, Verbraucher anderer Mitgliedstaaten als Kunden zu gewinnen, beispielsweise das Anbieten von Dienstleistungen oder Güter in mehreren namentlich benannten Mitgliedstaaten.
- Ausgaben des Unternehmers für Internetreferenzierungsdienste von Suchmaschinenbetreibern, um in anderen Mitgliedstaaten wohnenden Verbrauchern den Zugang zu seiner Website zu erleichtern.
- Der internationale Charakter der fraglichen Tätigkeit, wie bestimmter touristischer Tätigkeiten.
- Die Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl.
- Die Verwendung eines anderen Domänennamens oberster Stufe als dem des Mitgliedstaats, in dem der Gewerbetreibende niedergelassen ist, z. B. „.de“, oder die Verwendung neutraler Domänennamen oberster Stufe wie „.com“ oder „.eu“
- Die Wiedergabe von Anfahrtsbeschreibungen von einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten aus zum Ort der Dienstleistung.
- Die Erwähnung einer internationalen Kundschaft, die sich aus in verschiedenen Mitgliedstaaten wohnhaften Kunden zusammensetzt, insbesondere durch die Wiedergabe von Kundenbewertungen.
- Die Verwendung einer anderen Sprache oder Währung als der im Mitgliedstaat des Gewerbetreibenden üblicherweise geltenden.
Keine Anhaltspunkte seien jedoch die Angabe der elektronischen oder geografischen Adresse des Gewerbetreibenden auf der Website oder die seiner Telefonnummer ohne internationale Vorwahl, denn solche Angaben liessen nicht erkennen, ob der Gewerbetreibende seine Tätigkeit auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten orientiere.
Fazit:
Entscheidend für den Gerichtsstand im Internet ist die „Ausrichtung“ der gewerblichen Tätigkeit. Dabei kommt es auf den Willen des Unternehmers an, im jeweiligen Land tätig zu sein. Anhaltspunkt für den Willen ist, ob der Website und der gesamten Tätigkeit des Unternehmers entnommen werden kann, dass diese ihre Geschäfte auch in anderen Ländern tätigen wollten, bzw. dass sie dazu bereit waren. Der EuGH hat damit ein weitreichendes Urteil für den Online-Handel gefällt. Er präzisierte die unionsrechtlichen Regeln über die gerichtliche Zuständigkeit für Verbraucherverträge im Internet.
Quellen: Gerichtshof der Europäischen Union, Pressemitteilung Nr. 118/10 v. 7. 12. 2010; Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-585/08 und C-144/09 v. 7. 12. 2010;
Rechtsnormen: Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Handelssachen (ABl. 2001, L 12, S. 1).