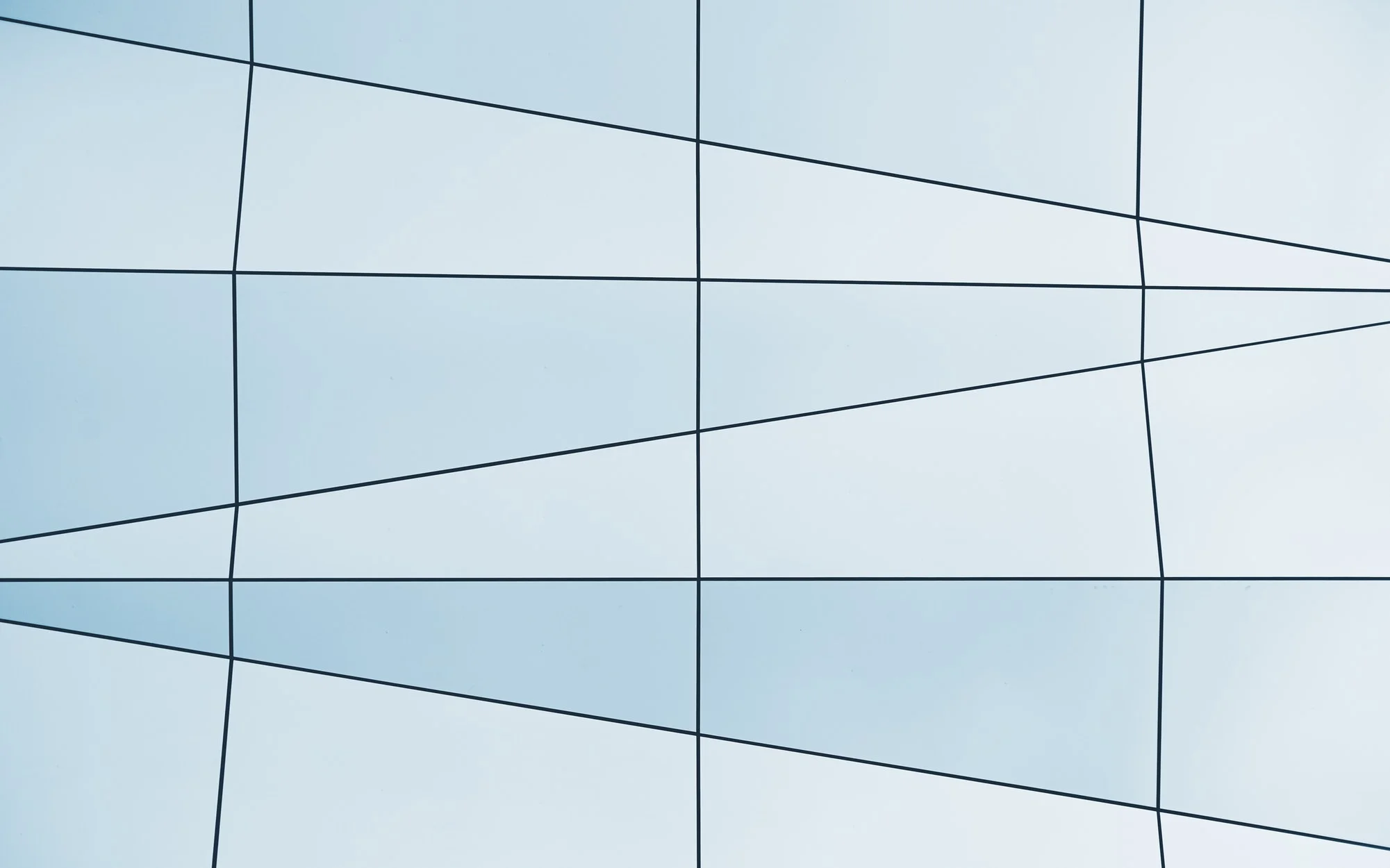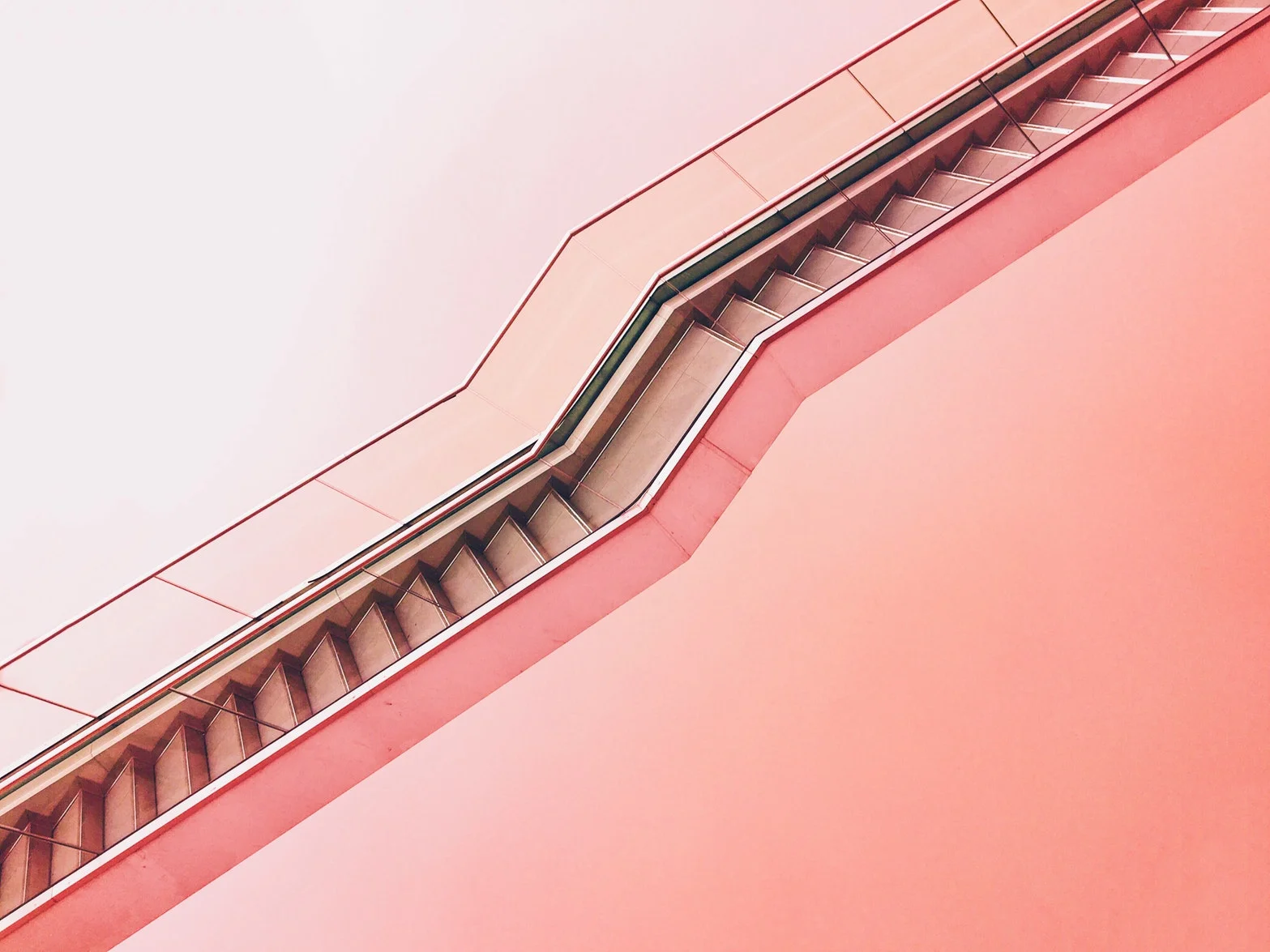Pressemitteilung Nr. 124/2017 des Bundesgerichtshofs vom 27.07.2017
Bundesgerichtshof legt Europäischem Gerichtshof Fragen zum Umfang des urheberrechtlichen Zitatrechts der Presse vor
Beschluss vom 27. Juli 2017 – I ZR 228/15 – Reformistischer Aufbruch
Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Abwägung zwischen dem Urheberrecht und den Grundrechten auf Informations- und Pressefreiheit sowie zum urheberrechtliche Zitatrecht der Presse und zur Schutzschranke der Berichterstattung über Tagesereignisse vorgelegt.
Der Kläger ist seit dem Jahr 1994 Mitglied des Bundestags. Er ist Verfasser eines Manuskripts, in dem er sich gegen die radikale Forderung einer vollständigen Abschaffung des Sexualstrafrechts wandte, aber für eine teilweise Entkriminalisierung gewaltfreier sexueller Handlungen Erwachsener mit Kindern eintrat. Der Text erschien im Jahr 1988 als Buchbeitrag. Im Mai 1988 beanstandete der Kläger gegenüber dem Herausgeber des Buchs, dieser habe ohne seine Zustimmung Änderungen bei den Überschriften vorgenommen, und forderte ihn auf, dies bei der Auslieferung des Buchs kenntlich zu machen. In den Folgejahren erklärte der Kläger auf kritische Resonanzen, der Herausgeber habe die zentrale Aussage seines Beitrags eigenmächtig wegredigiert und ihn dadurch im Sinn verfälscht.
Im Jahr 2013 wurde in einem Archiv das Originalmanuskript des Klägers aufgefunden und ihm wenige Tage vor der Bundestagswahl zur Verfügung gestellt. Der Kläger übermittelte das Manuskript an mehrere Zeitungsredaktionen als Beleg dafür, dass es seinerzeit für den Buchbeitrag verändert worden sei. Einer Veröffentlichung der Texte durch die Redaktionen stimmte er nicht zu. Er stellte allerdings auf seiner Internetseite das Manuskript und den Buchbeitrag mit dem Hinweis ein, er distanziere sich von dem Beitrag. Mit einer Verlinkung seiner Internetseite durch die Presse war er einverstanden.
Vor der Bundestagswahl veröffentlichte die Beklagte in ihrem Internetportal einen Pressebericht, in dem die Autorin die Ansicht vertrat, der Kläger habe die Öffentlichkeit jahrelang hinters Licht geführt. Die Originaldokumente belegten, dass das Manuskript nahezu identisch mit dem Buchbeitrag und die zentrale Aussage des Klägers keineswegs im Sinn verfälscht worden sei. Die Internetnutzer konnten das Manuskript und den Buchbeitrag über einen elektronischen Verweis (Link) herunterladen. Die Internetseite des Klägers war nicht verlinkt.
Der Kläger sieht in der Veröffentlichung der Texte eine Verletzung seines Urheberrechts. Er hat die Beklagte auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen.
Bisheriger Prozessverlauf:
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Das Oberlandesgericht hat angenommen, die Veröffentlichung der urheberrechtlich geschützten Texte des Klägers ohne seine Zustimmung sei auch unter Berücksichtigung der Meinungs- und Pressefreiheit der Beklagten weder unter dem Gesichtspunkt der Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG*) noch durch das gesetzliche Zitatrecht (§ 51 UrhG**) gerechtfertigt. Mit ihrer vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Vorlage des Bundesgerichtshofs an den Europäischen Gerichtshof:
Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vorgelegt.
Zum einen sind im Streitfall die Fragen entscheidungserheblich, die der Senat bereits in der Sache „Afghanistan Papiere“ zum Gegenstand eines Vorlagebeschlusses gemacht hat (BGH, Beschluss vom 1. Juni 2017 – I ZR 139/15, vgl. Pressemitteilung Nr. 87/2017 vom 1. Juni 2017). Darüber hinaus umfasst der Vorlagebeschluss Fragen zu den Voraussetzungen der Schutzschranken der Berichterstattung über Tagesereignisse und des Zitatrechts.
So hat der Bundesgerichtshof dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken im Internetportal eines Presseunternehmens bereits deshalb nicht als erlaubnisfreie Berichterstattung über Tagesereignisse gemäß Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 der Richtlinie 2001/29/EG*** anzusehen ist, weil es dem Presseunternehmen möglich und zumutbar war, vor der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke des Urhebers seine Zustimmung einzuholen.
Nach Ansicht des Bundesgerichtshof stellt sich im Streitfall weiter die Frage, ob es an einer Veröffentlichung zum Zwecke des Zitats gemäß Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG**** fehlt, wenn zitierte Textwerke oder Teile davon nicht – beispielsweise durch Einrückungen oder Fußnoten – untrennbar in den neuen Text eingebunden werden, sondern im Internet im Wege der Verlinkung als selbständig abrufbare PDF-Dateien öffentlich zugänglich gemacht und unabhängig von der Berichterstattung der Beklagten wahrnehmbar werden.
Der Bundesgerichtshof hat dem EuGH ferner die Frage vorgelegt, wann Werke im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG der Öffentlichkeit rechtmäßig zugänglich gemacht wurden und ob darauf abzustellen ist, dass die Werke in ihrer konkreten Gestalt bereits zuvor mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht waren. Das ist vorliegend fraglich, weil der Buchbeitrag des Klägers im Sammelband in einer veränderten Fassung erschienen und das Manuskript des Klägers auf seiner Internetseite mit den Distanzierungsvermerken veröffentlicht ist.
Vorinstanzen:
LG Berlin – Urteil vom 17. Juni 2014 – 15 O 546/13
Kammergericht Berlin – Urteil vom 7. Oktober 2015 – 24 U 124/14
*§ 50 UrhG lautet:
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, die im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig.
**§ 51 UrhG lautet:
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. […]
***Art. 5 Abs. 3 Buchst. c Fall 2 der Richtlinie 2001/29/EG lautet:
Die Mitgliedstaaten können für die Nutzung von Werken in Verbindung mit der Berichterstattung über Tagesereignisse in Bezug auf die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte Ausnahmen und Beschränkungen vorsehen, soweit es der Informationszweck rechtfertigt und sofern – außer in Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist – die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, angegeben wird.
***Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG lautet:
Die Mitgliedstaaten können für Zitate zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen in Bezug auf die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte Ausnahmen und Beschränkungen vorsehen, sofern sie ein Werk betreffen, das der Öffentlichkeit bereits rechtmäßig zugänglich gemacht wurde, sofern – außer in Fällen, in denen sich dies als unmöglich erweist – die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers angegeben wird und sofern die Nutzung den anständigen Gepflogenheiten entspricht und in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist.
Quellen: