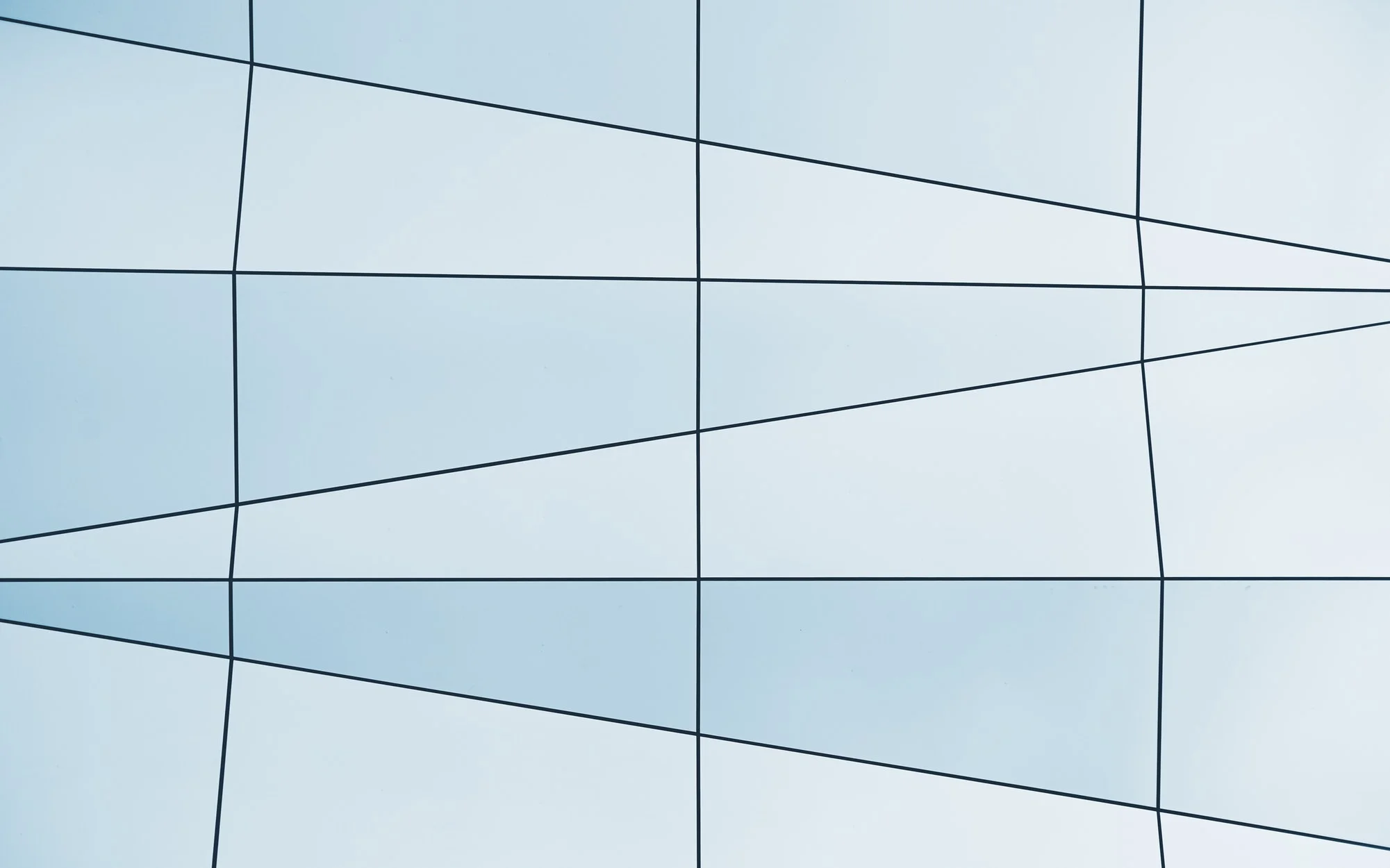Greenpeace gewinnt Rechtstreit: Verwendung des Begriffs „Gen-Milch“ ist nach deutschem Recht nicht verfassungswidrig. Die Umweltorganisation Greenpeace hat im Rechtsstreit mit der Molkerei Müller letztinstanzlich Recht bekommen. Die öffentlichen Verwendung des Begriffs „Gen-Milch“ ist nicht verfassungswidrig. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat dem Milchkonzern einen Anspruch auf Unterlassung versagt. Milch, die mit gentechnisch veränderten Futterpflanzen hergestellt wurde, darf von Greenpeace als „Gen-Milch“ bezeichnet werden. Das BVerfG in Karlsruhe bestätigte damit ein zuvor gefälltes Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofes (BGH). Die Molkerei Müller hatte seit mehreren Jahren und durch einige Instanzen hindurch Greenpeace die Verwendung des Begriffs „Gen-Milch“ verbieten zu lassen wollen.
Greenpeace hatte es sich u. a. zum Ziel gesetzt, die Verbraucher über ihrer Ansicht nach bestehende Risiken infolge des Einsatzes gentechnisch veränderter Organismen bei der Lebensmittelerzeugung aufzuklären. Deshalb forderten sie den Milchkonzern auf, ihren Milchlieferanten zur Auflage zu machen, auf gentechnisch veränderte Futtermittel zu verzichten. Nachdem die Molkerei dieser Forderung nicht nachgekommen war, bezeichnete Greenpeace die von der Klägerin vertriebene Milch in verschiedenen öffentlichen Aktionen als „Gen-Milch“, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Dagegen legte die Molkerei Rechtsmittel ein. Sie sah in der Formulierung „Gen-Milch“ in Bezug auf ihre Erzeugnisse die unwahre Tatsachenbehauptung, dass die von ihren Unternehmen verarbeitete Milch ihrerseits gentechnisch behandelt sei.
Der BGH wies dieses Unterlassungsbegehren zuvor zurück. Zur Begründung führte es aus: Der Gebrauch des Begriffs „Gen-Milch“ durch den Beklagten genieße den Schutz des Grundrechts auf Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz, dem bei der gebotenen Abwägung der Vorrang gegenüber den ebenfalls grundrechtlich geschützten Interessen der Beschwerdeführerin zukomme. Weiter sei der Begriff „Gen-Milch“ für sich genommen substanzarm, denn sein Bedeutungsgehalt ergebe sich erst aus dem Kontext, in dem er geäußert worden sei. Danach enthalte die beanstandete Formulierung keine unwahre Tatsachenbehauptung, denn der Beklagte habe unzweideutig bei allen Aktionen zum Ausdruck gebracht, dass sich sein Protest gegen die Verwendung von gentechnisch veränderten Futtermitteln richte. Auch den Vorwurf, die von den Unternehmen der Beschwerdeführerin verwendete Milch selbst sei gentechnisch verändert, könne nicht geschlossen werden.
Auch das BVerfG hält den Begriff für zulässig und stimmte dem BGH zu. Dem durch die Meinungsfreiheit geschützten Äußerungsinteresse von Greenpeace sei der Vorrang vor dem entgegenstehenden Unterlassungsinteresse der Molkerei einzuräumen. Weiter sei auch die Annahme des BGH richtig gewesen, er dürfe bei seiner Abwägung zwischen den beiderseits betroffenen rechtlich geschützten Interessen maßgeblich darauf abstellen, dass die Molkerei jedenfalls nicht im gesamten Produktionsprozess auf gentechnische Verfahren verzichte und somit die Kritik an ihrem Geschäftsgebaren nicht jeglicher zutreffender Tatsachengrundlage entbehre. Die Verwendung des Begriffs „Gen-Milch“ sei demnach zulässig, auch wenn die Milch selbst nicht gentechnisch verändert wurde.
Quellen: BVerfG, Beschluss vom 8. September 2010 1 BvR 1890/08. Pressemitteilung Nr. 80/2010 vom 22. September 2010.